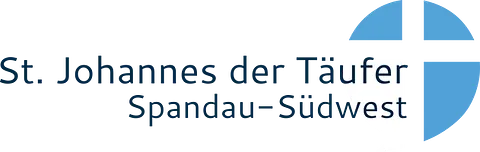Interview mit Pfarrer Weimann
Pfarrer Dieter Weimann wurde 1943 in Meseritz, Ostbrandenburg (Polen) geboren. Er verbrachte dort Kindheit und Schulzeit, während der er immer wieder im elterlichen Schmiedebetrieb mithalf. Mit 16 Jahren siedelte er mit seinen Eltern ins Rheinland um und erlernte den Beruf des Büromaschinenmechanikers, in dem er 5 Jahre arbeitete. Während dieser Zeit reifte der Gedanke, die Schulbildung fortzusetzen. Nachdem er am Abendgymnasium das Abitur nachgeholt hatte, nahm er in Paderborn und später in Bonn das Studium der Theologie sowie Psychologie und Philosophie (als Nebenfächer) auf. Nach dem Abschluss des Studiums absolvierte er ein Pfarrpraktikum und besuchte anschließend das Priesterseminar. Nach der Priesterweihe arbeitete er in Bonn, dem Bergischen Land und im Kölner Bereich als Kaplan und Pfarrvikar. Seine letzte Pfarrei in Morsbach betreute er 18 Jahre lang. Er setzte sich vor allem für die Familien- und Jugendarbeit in seinen Pfarrstellen ein. Ihm lag immer daran, dass ein aufgeschlossener Glaube auch in unserer Zeit Brücken baut zum Wohl und Heil der Menschen. Seit seiner Pensionierung lebt er in Falkensee und arbeitet als Subsidiar in unserer Pfarrei.
Wann und warum haben Sie sich für das Theologiestudium entschieden?
Ohne die religiöse Atmosphäre von der Mutter her könnte ich mir mein Christsein schlecht vorstellen. Ich bekam durch sie ein Empfinden, dass Religion, also alles, was mit dem Glauben zu tun hat, etwas Gutes, etwas Wertvolles sein muss. Mit 20 Jahren war ich mir sicher, dass ich nicht in meinem damaligen Beruf bleiben wollte und der Wunsch kam auf, mich stärker religiös zu engagieren. Ich hatte ja viel mit Leuten zu tun gehabt. Ich habe die Menschen in Fabriken und ihrer Arbeitswelt kennengelernt. Für mich stellte sich das so dar, dass die Welt draußen mit dem Religiösen fast nichts zu tun hatte, so eine Art Sonntagsglaube. Hier eine Brücke zu schlagen zwischen Arbeitswelt und religiöser Welt wurde mein Anliegen. Religionslehrer wäre auch eine Option gewesen, aber im Gespräch mit Schulklassen über ihre Erwartungshaltung, habe ich gespürt, dass da eine dringendere Aufgabe im kirchlichen Dienst auf mich wartete als Seelsorger, ja, als Priester. Schwerpunktmäßig habe ich mich immer der Jugend und jungen Erwachsenen verpflichtet gefühlt.
Wie viele Gemeinden haben Sie im Laufe Ihres Berufswegs mitbetreut?
Ja, wie viele? Wenn ich mit meiner ersten Praktikumsstelle anfange und alle Stellen in Köln, Bonn, der Insel Juist und dem Bergischen Land zusammenzähle, komme ich auf 18 Gemeinden. Meine letzte Stelle war die Pfarrei in Morsbach. Dort war ich 18 Jahre lang. Da bin ich auch gefragt worden, wie ich so zehn Jahre da war: „Ja, wie lange bleiben Sie denn noch hier?“ Hat ja zwei Seiten so eine Frage, nicht? Ich habe gesagt, so lange sie mich ertragen. „Wir wollen, dass sie noch lange bleiben!“, war die Antwort. Und so sind es noch acht weitere Jahre geworden. Zum Schluss gab es eine große Abschiedsfeier, an die ich mich sehr gerne erinnere.
Wo haben Sie sich am wohlsten gefühlt?
Ja, das hat mich meine Schwester auch mal gefragt. Viele meiner Stellen waren ja zeitlich begrenzt. Ich kann sagen, dass ich mich überall, wo ich war, wohl gefühlt habe. Ich kam nie mit Leuten über Kreuz, wie man so sagt. Also persönlich. Aber die letzte Stelle in Morsbach war doch der Höhepunkt gewesen. Sonst hätten beide Seiten das gar nicht so lange miteinander ausgehalten (lacht). Aber ich kann sagen: Bonn war meine erste Liebe, und Morsbach, das war meine große Liebe.
Wie muss man sich Ihre Woche vorstellen?
Das ist ganz unterschiedlich und schwer vorherzusagen. Wenn jemand in Urlaub ist, übernehme ich die Vertretung. Ansonsten bin ich mit Gottesdiensten, Taufen und Beerdigungen gut ausgelastet. Ich bin halt leider nicht mehr so belastbar wie in jüngeren Jahren. Vor allem die Hitze der letzten Tage hat mir schon zu schaffen gemacht.
Sie blicken auf einige Jahrzehnte Priestertätigkeit zurück. Wie beurteilen Sie die Entwicklung der katholischen Kirche innerhalb dieser Zeit?
Die Spannungen innerhalb der Kirche haben zugenommen. Auf der einen Seite gibt es die, die Angst haben, dass man Wertvolles wegwirft wie in dem Märchen vom „Hans im Glück“. Er wirft alles weg, weg, weg und steht am Ende mit leeren Händen da. Das ist die eine Gefahr. Auf der anderen Seite gibt es die, die überzeugt sind, dass das im Grunde genommen ein absterbender Ast wird, wenn sich nichts ändert. Die Kirche steht in dieser Spannung zwischen konservativ, teilweise schon rückwärtsgewandt und progressiv in eine Richtung, die nicht nur Reform, sondern sogar Reformation will. Und hier gilt es, den goldenen Mittelweg zu gehen, die Spannung auszuhalten, die einen nicht vor den Kopf zu stoßen und die anderen nicht zu verlieren.
Ich rufe mir oft den Satz in Erinnerung: „Überall dort, wo berechtigte Reformen unterlassen oder unterdrückt werden, darf man sich nicht wundern, wenn es zur Reformation bzw. Revolution kommt.“
Die Kirche hat in den letzten Jahrzehnten vieles unterlassen, was man hätte angehen sollen. Daher denke ich, dass es die Kirche auch nicht mehr in so einem monolithischen Block geben wird. Das sehen wir ja auch in allen anderen kulturellen, wirtschaftlichen, politischen Situationen.
Die katholische Kirche wurde und wird oft zu sehr als Rom orientiert verstanden. Sie ist nicht nur Rom zentriert, sondern sie ist auch weltweit orientiert. Katholisch heißt – auch hier wieder zwei Seiten – einerseits zentriert und andererseits weltweit, weltumfassend, allgemein.
Spannung können wir nur überwinden durch Geschwisterlichkeit und durch soziale Maßnahmen. Es geht immer um die Menschen. Um des Menschen willen ist Gott in die Welt gekommen, nicht einer Sache willen, nicht einer Religion, einer Doktrin, einer Überzeugung willen, sondern um des Menschen willen und seines Heils..
Wie sehen Sie auf den synodalen Weg im Erzbistum Berlin? Was erwarten Sie von ihm und wo sehen Sie Grenzen?
Es ist ein Suchen. Die Erlösung hat schon stattgefunden. Es liegt nur noch an uns, wie wir sie entsprechend annehmen und wie wir damit arbeiten. Es gibt Kräfte, die positiv wirken, und es gibt aber auch Kräfte, die bremsen und verhindern wollen. Gut ist, dass die Führung mit unserem Erzbischof positiv eingestellt ist. Ich erwarte, dass da ein Aufbruch kommt. Auch Frauen sollen den Zugang zum Diakonat haben. Das ist so eine Traumvorstellung, hier muss sich was ändern. Und ich wünsche mir eine freiwillige Offenheit dafür, dass auch Verheiratete Priester sein oder Priester auch Familie haben können. Mir wird aber über den Inhalt des Glaubens zu wenig gesprochen, und das nicht gelassen, offen und kritisch genug. Ja, das vermisse ich sehr. Und was wird für Familien, die nicht mehr am liturgischen Dienst teilnehmen, gemacht? Heute ist es wichtiger, die Leute erst mal abzuholen. Nachhaltige Veränderungen können aber nicht ruckartig wie mit der Notbremse erfolgen. Es muss stufenweise geschehen und man muss die Leute mitnehmen. Wenn das zu eng gedacht wird, dann ist das eingeengt. Wir sind keine Sekte und wir wollen eine Volkskirche bleiben, wie auch immer sie aussehen mag.
Was gefällt Ihnen an der neuen Pfarrei St. Johannes der Täufer besonders gut?
Ich denke, wir haben die Möglichkeit zu differenzieren. Wir werden mit den verschiedensten Fragen, Problemen und unterschiedlichen Positionen im Glauben konfrontiert. Die verschiedenen Erfahrungen und Fähigkeiten eines größeren Pastoralteams ermöglichen es uns, hier gezielter und besser Hilfestellung anzubieten.
Gibt es etwas, was Sie in Spandau vermissen?
Ja, eine gewisse Offenheit, diese Offenheit und den Mut wie im Lied GL 907, neue Wege zu gehen. Den Mut zu haben, Neues zu versuchen ohne Wertvolles auf der Strecke zu lassen. Und diese Offenheit, über den Glauben auch zu sprechen.
Wie sehen Sie auf den synodalen Weg im Erzbistum Berlin? Was erwarten Sie von ihm und wo sehen Sie Grenzen?
Auch wenn ich viele Jahre im Rheinland verbracht habe, so bin ich ja doch in Brandenburg geboren und aufgewachsen. Ich bin also in meine ursprüngliche Heimat zurückgekehrt und werde hier meinen Ruhestand verbringen.

Herr Pfarrer Weimann, ich bedanke mich vielmals für dieses Gespräch und wünsche Ihnen noch viele Jahre bei bester Gesundheit hier in Berlin und Brandenburg.
Gerhard Bauer