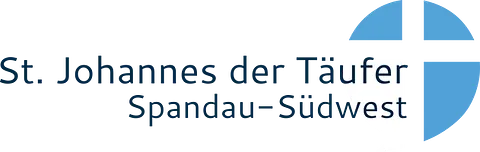Ein Interview mit
Pfarrer Sylwester Gorczyca
Pfarrer Dr. Sylwester Gorczyca wurde 1952 in Jaslo in Polen geboren. Er verbrachte dort Kindheit und Schulzeit bis zum Abitur. Nach dem Abitur trat Sylwester Gorczyca 1972 in den Franziskanerorden ein und begann in Krakau, Theologie und Philosophie zu studieren. Er wurde 1979 im Kloster von Niepokalanow, das von Pater Maximilian Kolbe gegründet worden war, zum Priester geweiht. Nach fünf Jahren pastoraler Arbeit in Polen, ging er nach Rom, und setzte dort seine Studien fort, die er mit einer Promotion abschloss. Während seiner Arbeit an der Promotion arbeitete er in Kalabrien mit jungen Menschen. Im Jubiläumsjahr 2000 nahm er an den Feierlichkeiten in Rom teil. Im gleichen Jahr trat er aus dem Orden aus und wurde 2001 nach Deutschland geschickt, um Deutsch zu lernen. Der Plan war, dass er nach einiger Zeit wieder nach Rom zurückkehren sollte. Zunächst war er in Königswinter als Pfarrvikar tätig und übernahm danach die Seelsorge der italienischen Gemeinden in Saarbrücken, Hamburg und Frankfurt. Als 2019 seine Pensionierung anstand, wurde er nach Berlin gesandt, um hier ebenfalls die italienische Gemeinde zu unterstützen.
Letztendlich entschied der Bischof aber, dass Pfarrer Gorczyca nach Spandau in die Gemeinde St.
Maximilian Kolbe und St. Wilhelm gehen sollte, wo er seitdem als Pfarrvikar tätig ist.
Wie sind Sie zur Theologie gekommen?
Nach meiner Erstkommunion wurde ich Messdiener. Das hat mir bereits eine deutliche Orientierung gegeben, die mit der Zeit weiter gewachsen ist. Die Nähe zu den dort ansässigen Franziskanern und das allmähliche Zusammenwachsen mit der Klostergemeinschaft haben mich dann in meinem Wunsch bestärkt, Theologie zu studieren.
Was hat Sie bewogen nach Rom zu gehen und eine Doktorarbeit zu beginnen?
Mein erstes Ziel war nicht, Diözesanpriester in Polen zu werden. Aber ich hatte ein sehr großes Interesse für die Liturgie und die Sakramente entwickelt. Ich wollte gerne als Lehrer an eine Universität gehen. Daher entschloss ich mich, in Rom weiter zu studieren. In Sant‘ Anselmo bei den Benediktinern vertiefte ich mein Wissen über die Liturgie und an der Gregoriana über die Sakramente.
Können Sie kurz zusammenfassen, worum es inhaltlich bei Ihrer Doktorarbeit ging?
Ich habe mich mit der Entwicklung des Stundengebets für Priester, dem Brevier, ab dem 16. Jhd. beschäftigt. Francisco de Quinones, ein spanischer Franziskaner, erarbeitete ein reformiertes Brevier im Auftrag von Papst Clemens VII. Die Änderungen, die er vorschlug, wurden intensiv diskutiert, bejaht, verworfen, wieder begutachtet und sind schließlich in die Reformen des 2. Vatikanischen Konzils teilweise eingeflossen. Diese Entwicklungen habe ich in meiner Arbeit aufgezeigt.
Sie haben anschließend einige Zeit in Kalabrien in den Reihen der Franziskaner-Minoriten gearbeitet. Was waren die Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit dort?
Ich habe viele pastorale Besuche gemacht, viel gepredigt und für den Orden geworben, um Nachwuchs für die Franziskaner zu finden. Einige der jungen Leute, die ich damals begeistern konnte, sind heute Priester und Professoren an Universitäten. Die Franziskanerprovinz in Kalabrien wurde zu der Zeit bekannt für hohe Nachwuchszahlen.
Was hat Sie 2001 nach Deutschland gebracht?
Ein Beichtvater am Hl. Stuhl in Rom plante, nach Deutschland zurückzugehen und man suchte einen Nachfolger. Ich wurde ausgewählt und sollte für einige Jahre nach Deutschland gehen, um Deutsch zu lernen und dann seine Stelle zu übernehmen. Ich begann in Köln mit Deutschkursen und wurde dann nach Königswinter als Pfarrvikar geschickt.
Sie waren in Deutschland Pfarrer der italienischen Missionen in Hamburg und dann in Frankfurt. Wie viele Mitglieder hatte Ihre Gemeinde und was waren die größten Herausforderungen?
Zur Größe kann ich keine präzisen Angaben machen. Ausländische Gemeinden haben keine festen Grenzen. In Hamburg waren es etwa 7.000 Menschen. Davon kamen etwa 70 regelmäßig zur Messe. Zweimal im Monat ging ich noch nach Lübeck und Bremen. Ich war also viel unterwegs und hatte drei größere Gemeinden parallel zu betreuen. Die Sakramenten- Vorbereitung war unter diesen Gegebenheiten auch herausfordernd. Wir haben auch Bibelkurse veranstaltet und Hilfsangebote im sozialen Bereich für arme Menschen und Obdachlose organisiert. Die Arbeit in Gefängnissen war auch wichtig. Vielen jungen Menschen konnte damit geholfen werden, wieder Fuß zu fassen.
Was sind die markantesten Unterschiede Ihrer Arbeit in den verschiedenen Ländern?
Die Mentalitäten, Italiener sind sehr offen, in Deutschland ist dies etwas anders. Königswinter liegt in Nordrhein-Westfalen. Dieser Menschenschlag ist vollkommen anders als der, den ich in Hamburg oder Frankfurt angetroffen hatte. Die Leute in Königswinter kannten sich, haben sich auf der Straße begrüßt. Das war in Hamburg und Frankfurt nicht der Fall. Wir haben aber überall gute Gemeinden gehabt. Ich hatte nie Probleme mit den verschiedenen
Mentalitäten. Ehrlich gesagt, war es ja auch einfach für mich. Ich hätte immer nach Italien zurückgehen können, was ich aber nicht vorhatte.
Wo haben Sie sich am wohlsten gefühlt?
In Königswinter. Dort konnte ich meiner Leidenschaft, Tennis zu spielen, besonders gut frönen. Auch für andere sportliche Aktivitäten wie Schwimmen, Schifahren und Radfahren war es ideal. In Italien liebte ich das Meer. Auch dort ging ich regelmäßig schwimmen.
Was sind die größten Herausforderungen in Ihrer Arbeit für die Gemeinden St. Wilhelm und St. Maximilian Kolbe?
Auf Grund meines Alters ist es nicht einfach, Kontakt zu jungen Leuten zu bekommen. Sie wünschen sich einen jüngeren Priester. Ich würde gerne junge Familien aktivieren. Das wäre wichtig, denn ohne junge Familien gibt es keine Zukunft. Aber da tue ich mich schwer. Ich würde die Eltern gerne in die Katechese miteinbeziehen, so dass Kinder auch vom Elternhaus unterstützt werden, nach der Erstkommunion zu bleiben und nicht wieder zu verschwinden.
Die Corona Zeit hat ja Spuren im Besuch der Gottesdienste hinterlassen. Sehen Sie Möglichkeiten, das zu ändern?
Vielleicht haben wir mit der Reduktion des Messangebotes einen Fehler gemacht. Viele nutzen immer noch die Medien, um an einer sonntäglichen Messfeier teilzunehmen. Das ist schwer zu ändern. In den vergangenen drei Jahren sind auch wieder Leute gestorben oder haben gesundheitliche Probleme bekommen, die früher in die Kirche kamen. Die Corona-Zeit hat auch viele Familien von der Kirche entfernt. Man hat sich daran gewöhnt, nicht in die Kirche zu gehen. Der Glaube ist nach wie vor vorhanden, wird aber mehr in sozialen Aktivitäten ausgelebt. Aber langsam sehen wir auch, dass Leute wieder zurückkommen.
Was gefällt Ihnen an der Gemeinde St. Maximilian Kolbe und St. Wilhelm besonders gut?
Ich freue mich, dass Menschen immer noch zum Beten kommen. Wir lassen die Kirche am Morgen und am Abend im Vorraum offen, so dass Leute zum Allerheiligsten Sakrament kommen können. Es ist auch schön, dass sich immer Leute finden, die Gemeindefeste vorbereiten, wie neulich für St. Martin zum Beispiel. Wir haben auch Kontakte zur Religionslehrerin der naheliegenden Schule geknüpft und möchten in Zukunft enger zusammenarbeiten. Leider ist St. Wilhelm zurzeit geschlossen. Wahrscheinlich werden die dortigen Gemeindemitglieder sich eine näher liegende Alternative suchen.
Was müsste sich Ihrer Meinung nach innerhalb der katholischen Kirche ändern, damit wir auch in 50 Jahren noch lebendige Gemeinden haben?
Ich bin kein Prophet. Ich frage mich, ob die in Deutschland diskutierten Reformen wirklich etwas substantiell ändern würden? Ich würde sagen, dass die Krise der Kirche auch eine Krise der Gesellschaft ist. Die Scheidungszahlen für Ehepaare und der Materialismus, dem unsere Kinder ausgesetzt sind, hinterlässt Spuren. Wir haben alles. Wenige brauchen einen Gott, sie sind auch so glücklich. Der Missbrauchsskandal macht mich sehr traurig. Aber wir müssen uns ehrlich mit allem konfrontieren und wieder lernen, die Zeichen der Zeit zu lesen und sie genau zu reflektieren.
Gibt es etwas, was Sie in Deutschland vermissen?
Das kann ich so nicht sagen. Die Länder, in denen ich gelebt und gearbeitet habe, waren alle verschieden und ich habe jedes Land geschätzt. Als ich für die italienischen Gemeinden in Deutschland zuständig war, hatte ich eine große italienische und eine kleine deutsche Gemeinde. Jetzt ist es genau anders herum.
Aber das Meer in Italien habe ich geliebt.
Wie sehen Sie auf den synodalen Weg, den Papst Franziskus mit der Weltkirche beschreiten will und was sind Ihre persönlichen Erwartungen an diesen Prozess?
Wir müssen die Kirche reformieren, daran führt kein Weg vorbei. Der synodale Weg der Weltkirche bietet hierfür sicherlich ein gutes Forum und ist wahrscheinlich die Zukunft. Wir brauchen mehr Platz für Laien. Der Papst geht in diese Richtung. Persönlich erwarte ich, dass wir mehr eine Laienkirche werden und mehr Bereiche für Laien öffnen.
Wie schöpfen Sie neue Energie und wie verbringen Sie Ihre Freizeit?
Aus dem persönlichen Gebet und meinem Studium zur Vorbereitung von Predigten. Sport und Bücher lesen sind in der Freizeit meine Lieblingsbeschäftigungen.
Pfarrer Gorczyca, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch.
Gerhard Bauer